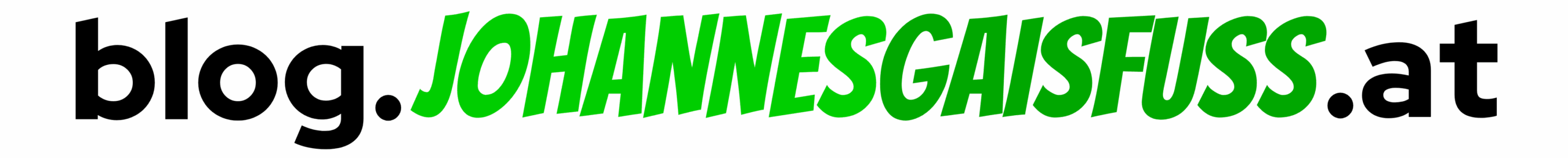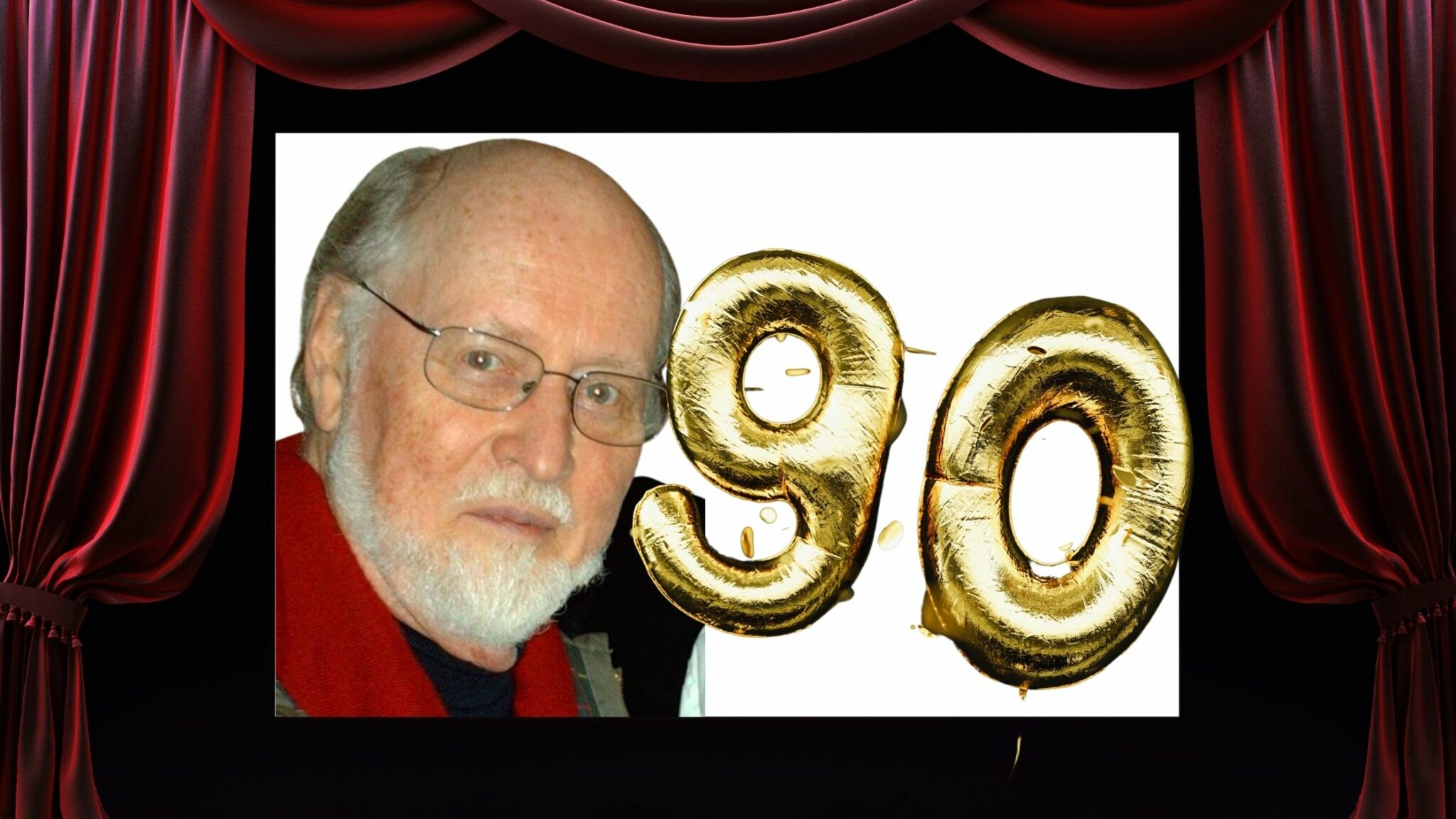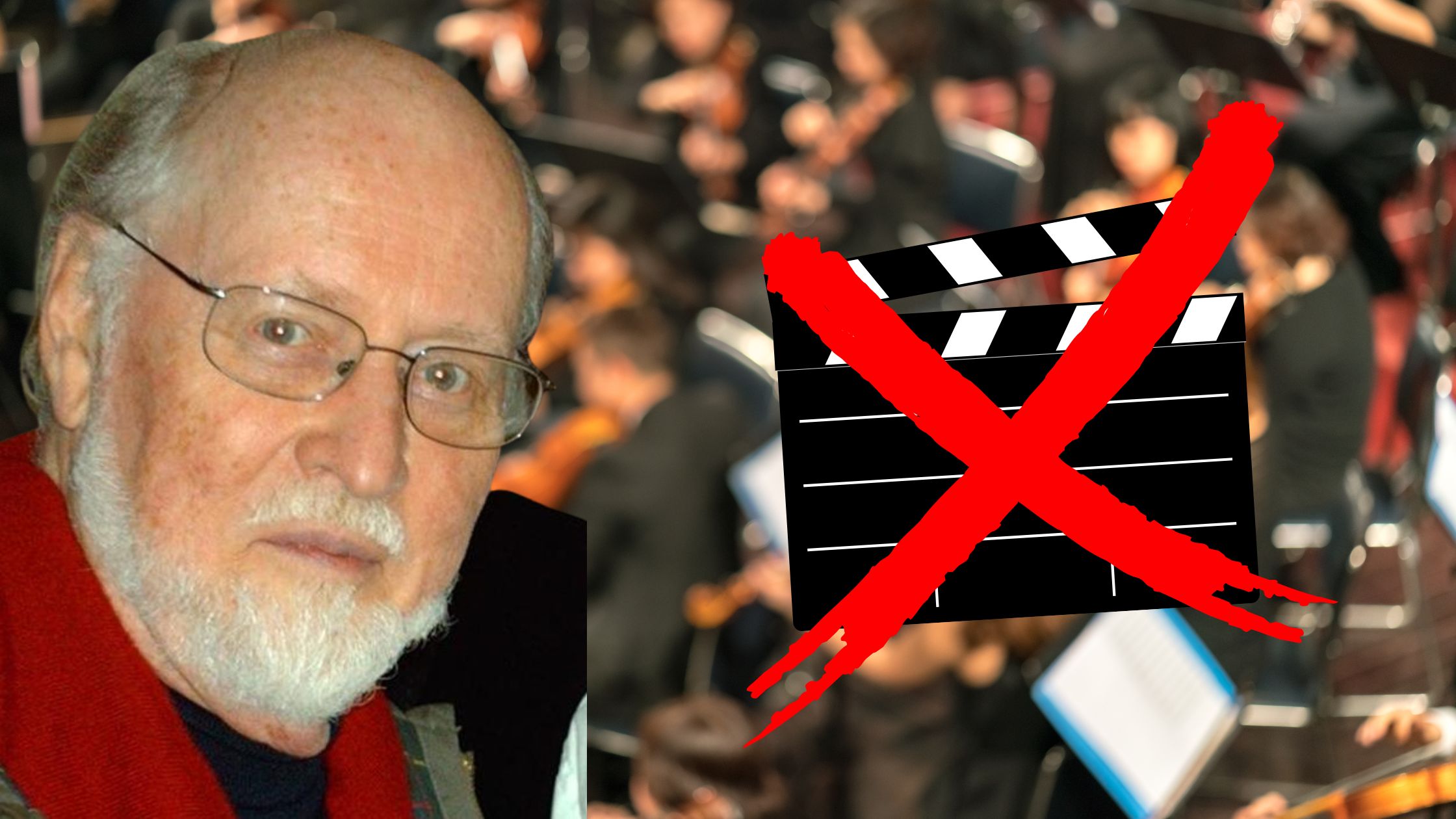Foto: © SF/Monika Rittershaus
Am 18. Juli 2025 werden die Salzburger Festspiele mit dem Konzert Das Floß der Medusa von Hans Werner Henze zum bereits 105. Mal eröffnet. Damit beginnt auch wieder jene Zeit, in der die gesamte Stadt ‚zur Bühne‘ wird. Von den Hauptgründern des Festivals – Max Reinhardt und Hugo von Hofmannsthal – war dieser Leitspruch primär so intendiert, dass die Stadt als Kulisse für die diversen Festspielproduktionen fungieren sollte – ihren Anfang mit der Aufführung von Hofmannsthals Jedermann auf dem Domplatz nehmend, der seit damals als das vielleicht prominenteste Beispiel für die Teilhabe des Stadtraums in der Inszenierung der diversen Festspielproduktionen gilt.
Egal, ob in diversen Kirchen, der (erst später in den Festspielhäuser-Komplex integrierte) Felsenreitschule, Gärten wie dem des Schlosses Leopoldskron oder dezidierten Theaterhäusern: In Salzburg werden seit 1920 die unterschiedlichsten Plätze bespielt. Doch erscheint es müßig, den Fokus ausschließlich darauf zu legen, inwiefern der Stadtraum im Rahmen von offiziellen Festspiel-Aufführungen ‚verwendet‘ wird, immerhin ist das zuvor erwähnte Motto längst zur Institution geworden und betrifft längst nicht nur diese.
Es lässt sich kaum negieren, dass Salzburg zur Festspielzeit nicht nur eine andere Atmosphäre als in allen anderen Monaten ausstrahlt, sondern tatsächlich auch sichtbar verändert erscheint (was sich gegenseitig zugrunde liegt und beeinflusst). Über die gesamte Stadt verteilt – sei es in der Innenstadt, sei es am Bahnhof – werben Plakate für die diversen Produktionen aus den Sparten Oper, Konzert und Schauspiel. Nicht zu vergessen die gigantischen Stoffbanner, oftmals zwischen Häusern angebracht, die selbiges Ziel verfolgen. Auf den Brücken, die ins Zentrum führen, wehen Fahnen mit dem Emblem des Festivals; einige Busse fahren mit kleineren Exemplaren derer auf dem Dach.
Überspitzt könnte man sagen, dass in den Monaten der Festspiele Salzburg zu einem Werbeträger inszeniert wird. Sowohl für die Veranstaltung selbst als auch für exklusive Marken wie beispielsweise der Luxusuhrenmanufaktur Rolex, die seit nunmehr 13 Jahren als einer der Hauptsponsoren des Festivals fungiert.
Doch warum haben sich Max Reinhardt und Hugo von Hofmannsthal so couragiert für Salzburg als Austragungsdestination solcher Festspiele eingesetzt?
Gewiss habe, so führt Malte Hemmerich aus, „die enge Verwobenheit der Stadt mit Wolfgang Amadeus Mozart“ einen beträchtlichen Anteil daran, schließlich gab es bereits am Ende des 19. Jahrhunderts diverse Veranstaltungen zu Ehren des Komponisten und seiner Musik.1 Darüber hinaus existierten ernsthafte Überlegungen für ein all- jährlich stattfindendes, Mozart gewidmetes Festival; doch konnte davon keine umgesetzt werden. Diese ‚Vorarbeit‘ in konzeptioneller und ideeller Hinsicht (noch heute liegt der Fokus der Festspiele auf Konzerten klassischer Musik und Opern) begünstigte Salzburg sicherlich als Ausrichtungsort, wie auch Clemens Panagl festgehalten hat.2
Dennoch wäre es nicht ausreichend, die Wahl des Festspielorts nur auf diese Gegebenheiten zurückzuführen, weil es verschleiern würde, wie sehr auch die Topografie der Stadt eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Ausgehend von den Notizen einer Rede, in der Hofmannsthal vor der Festspielhausgemeinde pro Salzburg argumentierte, folgert Hemmerich, dass das barocke Flair der sich „zwischen drei malerischen Berggipfeln“ befindenden und somit auch zur Sommerfrische einladenden Landeshauptstadt ein wesentlicher Faktor gewesen sei.3 Ferner habe Salzburg mit seinen „unzählbaren weiteren historischen Gebäuden“ bestochen.4 Nicht zuletzt habe Hofmannsthal Salzburg als Gegenpol zu den – dem damaligen Zeitgeist entsprechend – ablehnungswürdigen Großstädten rezipiert.
Wie sich aus diesen Ausführungen durchaus entnehmen lässt, scheint Salzburg auf den Literaten Eindruck von Exklusivität gemacht zu haben. Und um ebenjene Exklusivität respektive der Vermittlung dieses Images ist man insbesondere seit dem Prosperieren der Festspiele bemüht. Die aufgrund ihres Anspruchs, die ‚höchsten‘ Künste mit ausschließlich den profiliertesten Künstler*innen darzubieten, selbstverständlich stark daran mitbeteiligt sind.
Um das Image dieser möglichst exklusiven und reichen Stadt Salzburg aufrecht zu erhalten, wird mitunter auch politisch interveniert. Während in der Landeshauptstadt orts- und zeitunabhängig nur das Organisierte Betteln, das „aggressive Betteln oder Betteln mit Kindern“ untersagt sind, ist das sogenannte „‚Stille Betteln‘“ grundsätzlich gestattet.5 Dennoch gab es insbesondere seit Anfang der 2010er-Jahre immer wieder heftige Debatten um diese Personen und entsprechende Verbote. Zur Festspieleröffnung 2012 demonstrierten Aktivist*innen in der Hofstallgasse gegen die Kriminalisierung von Armutsbetroffenen. Der damalige Mitorganisator Lukas Uitz wird in den von der APA respektive den Salzburger Nachrichten wie folgt zitiert: „‚Alles, was arm und unangenehm ist, soll aus Salzburg heraus.‘“6 Nun zeigt diese Aussage nicht nur eine gewollte Inszenierung des Stadtraums auf; vor dem Hintergrund des Abhaltungsortes der genannten Demonstration eröffnet sie auch einen potentiellen Zusammenhang zwischen dem Festival und den Prohibitionen – auch, wenn das Direktorium der Salz- burger Festspiele dies stets dementierten.
Denn Faktum ist, dass weder die Festspiele – deren Anspruch es ist, ‚höchste‘ Kunst zu zeigen –, noch die Stadt selbst – die wiederum von den Tourismus-Einnahmen profitiert – Interesse daran haben, die zumeist finanziell sehr gut situierten Besuchenden den Bettlerinnen auszusetzen. Sowohl die Ziele der Stadt als auch die der Festspiele würde darunter leiden; weiters könnte das zuvor thematisierte Image der Exklusivität nicht aufrechterhalten werden.
Daher verbietet die Stadtregierung auch das ‚stille Betteln‘ während der Festivalzeiten im stark frequentierten Epizentrum der Festspiele. Im Gemeinderatsbeschluss vom 25. Oktober 2017 heißt es:
„In der Stadt Salzburg ist auch ein nicht unter § 29 Abs. 1 Z. 1 bis 3 des Salzburger Landessicherheitsgesetzes fallendes Betteln in der Hofstallgasse vom Herbert-von-Karajan-Platz bis zum Max-Reinhardt-Platz bergseitig während der Veranstaltungen zu Ostern und zu Pfingsten sowie während der Veranstaltungen ab der dritten Woche des Juli [sic!] und im August eines Kalenderjahres im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 23.00 Uhr“
untersagt.7
Tatsächlich wird diese Regulierung – jedoch möglichst unauffällig – von den Polizeibeamt*innen streng exekutiert. Denn aus persönlicher Erfahrung sind Be- gegnungen mit Bettler*innen in der Festspielgasse de facto nicht existent; was unbestreitbar sowohl auf das Image als auch Bilddokumente jeglicher Art Auswirkungen hat.
Nicht umsonst hat der Theaterwissenschaftler Jens Roselt darauf hingewiesen, dass (Stadt-)Rauminszenierungen durchaus problematisch zu betrachten sind, da „es auch immer um massive Machtkonstellationen und Machtdemonstrationen geht“, wie das hier aufgeführte Beispiel nachweisen sollte.8
Weiter oben habe ich schon davon gesprochen, dass die ganze Stadt während der Festspielzeit(en) zur Bühne wird. Wiewohl diese Konstatierung auch zu Zwecken des Marketings herangezogen wird (das Tourismusbüro der Stadt Salzburg wirbt mit dem Slogan „Salzburg – Die Bühne der Welt“),9 ist ihr doch ein weiterer wahrer Kern immanent. Dieser manifestiert sich beispielsweise auch daran, dass im sommerlichen Salzburg die Grenzen zwischen Bühne und Auditorium – sei es jetzt in einem dezidierten Festspielhaus oder auf der Freilichtbühne des Domplatzes – diffus sind. Gerade während der Sommermonate ist es keine Seltenheit, diversen Künstler*innen in der Stadt zu begegnen; nicht selten sind vor allem die Schauspielenden auch bereits in ihrem Kostüm und ihrer Maske anzutreffen.
So gibt es beispielsweise von Peter Lohmeyer, der in den Jahren 2013-2020 die Allegorie des Todes in Hofmannsthals Jedermann darstellte, Aufnahmen, wie er bereits seiner Rolle entsprechend geschminkt und im Kostüm mit dem Rad zum Domplatz gefahren ist. In den Jahren 2013-2016 (Inszenierung Brian Mertes/Julian Crouch) begann das Mysterienspiel überhaupt mit einer Prozession der Darsteller*innen durch die Stadt.10
Es scheint kaum eines weiteren Beweises bedürftig, wie sehr der Stadtraum Salzburgs zur Festspielzeit inszeniert wird. Im Zusammenhang mit dem Motto ‚Die ganze Stadt als Bühne‘ möchte ich an dieser Stelle nochmals das Stichwort Armut aufzugreifen: 2019 und 2020 übernahm Helmut Mooshammer die Rolle des Armen Nachbarn in Jedermann dar, und nutzte diese Allegorie auch, um auf marginalisierte Gruppen wie Bettler*innen aufmerksam zu machen sowie die Doppelmoral der Festspielgäste und der Stadt performativ auszustellen. Vor den Vorstellungen trieb sich der ebenfalls in Kostüm und Maske befindliche Mooshammer in der Nähe des Domplatzes herum, wo er die sich dort aufhaltenden Personen um Almosen ansprach. Wiewohl der Schauspieler tatsächlich nicht nur Ablehnung erfuhr, reagierten insbesondere die Festspielgäste während des Einlasses zur Domplatz-Bühne fast ausschließlich abweisend.
Faktisch niemand erkannte in ihm den Schauspieler, was 2019 sogar darin gipfelte, dass Mooshammer als realer Störfaktor für Gäste und Image angesehen und auf Grundlage der zuvor zitierten Verordnung vor der Jedermann-Premiere von der Polizei abgeführt wurde. Erst in letzter Minute konnten die Verantwortlichen der Festspiele erklären, dass Mooshammer dem Ensemble angehöre.11 Wodurch sich freilich eine weitere Debatte über Machtverhältnisse anstoßen ließe.
Dieses Exempel zeigt nun abermals deutlich auf, wie die Stadt ihre Exklusivität zu inszenieren versucht, aber auch – um einmal mehr mit Roselt zu sprechen – , „wie Räume Aufführungscharakter bekommen, indem zwischen ihren Besuchern, Benutzern oder Zuschauern etwas geschieht, das zum einen Teil strategisch geplant und kontrolliert, zum anderen Teil emergent ist.“12
Zum Schluss möchte ich nochmals auf den eingangs festgehaltenen Leitspruch der Festspiele eingehen: Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums, das die Festspiele 2020-21 begingen, wurde die Stadt auch zur Bühne diverser Kunstinstallationen gemacht, mit denen die Menschen interagieren konnten und die (in Kombination mit Infotafeln) symbolisch für geplante, aber schließlich nicht gebaute Festspielhäuser standen – beispielsweise am Kapuzinerberg oder im Mirabellgarten. Auf performative Weise wurde hier nochmals das Motto der Stadt als Bühne aufgegriffen respektive ausgestellt.
Hemmerich kommt schließlich zu dem Schluss, Salzburg hätte ohne das Festival eine andere Entwicklung genommen, „wäre kleinstädtischer, weniger international.“13 Was sich nicht zuletzt sichtbar am Erscheinungsbild der Stadt manifestiert. Die Errichtung der mächtigen Festspielhäuser in der Hofstallgasse hat das Aussehen Salzburgs nachhaltig geprägt – ebenso wie es das derzeit laufende Umbauprojekt Kulturbezirk 2030 tun wird, wenn es fertiggestellt ist.
Quellenverzeichnis
- Malte Hemmerich, 100 Jahre Salzburger Festspiele. Eine unglaubliche Geschichte in fünf Akten, mit einem Vorwort v. Helga Rabl-Stadler, Salzburg: ecowin 2019, S. 26. ↩︎
- Vgl. Clemens Panagl, „Die Stadt vor 100 Jahren“ , Die Weltbühne. 100 Jahre Salzburger Festspiele [Sonderheft der Salzburger Nachrichten], 2019, S. 32. ↩︎
- Hemmerich, 100 Jahre Salzburger Festspiele, S. 33. ↩︎
- A. a. O., S. 32f. ↩︎
- Stadt Salzburg, „Bettelverbote“, Magistrat der Stadt Salzburg, o. A., https://www.stadt-salzburg.at/bettelverbot, 16. 07. 2025. ↩︎
- APA, „Protest gegen Bettelverbot in Salzburg“ , Salzburger Nachrichten, 27. 07. 2012, https://www.sn.at/kultur/kunst/protest-gegen-bettelverbot-in-salzburg-5896921, 16. 07. 2025. ↩︎
- Stadt Salzburg, „Gemeinderatsbeschluß vom 25. Oktober 2017 (Amtsblatt Nr. 20/2017)“, Magistrat der Stadt Salzburg, o. A., https://www.stadt-salzburg.at/fileadmin/landingpages/recht/ortspolizeil_verordnungen/bettelverbot_verordnung.pdf, 16. 07. 2025. ↩︎
- Jens Roselt, „Wandel durch Annäherung. Praktiken der Raumnutzung in zeitgenössischen Aufführungen“ , Politik des Raumes. Theater und Topologie, hg. v. Erika Fischer-Lichte/Benjamin Wihstutz, München: Fink 2010, S. 177-187, hier: S. 186. ↩︎
- TSG Salzburg Tourismus GmbH, Salzburg. Die Bühne der Welt, https://www.salzburg.info/de, 16. 07. 2025. ↩︎
- Vgl. Andres Müry, Jedermann darf nicht sterben. Geschichte eines Salzburger Kults, Salzburg: Pustet 2014, S. 74f. ↩︎
- Vgl. Barbara Haimerl, „‚Sandler‘ mischt sich unter das Festspielvolk“ , Salzburger Nachrichten, 18. 08. 2020, S. 8-9. ↩︎
- Roselt, „Wandel durch Annäherung. Praktiken der Raumnutzung in zeitgenössischen Aufführungen“, S. 186. ↩︎
- Hemmerich, 100 Jahre Salzburger Festspiele, S. 19. ↩︎